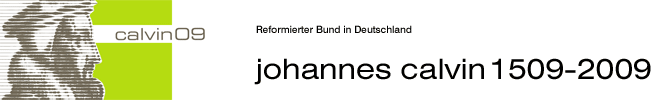Der Genfer Psalter
Calvin hatte das große Ideal vom liturgischen Gesang als lebendiger Verkündigung. Aber wie sah die Praxis aus? Gebrüll, grässliche Harmonien ohne erkennbaren Rhythmus. Den Gemeindegesang nachhaltig zu verbessern gelang erst Mitte des 20. Jahrhunderts.
Nach oben - E-Mail - Impressum - Datenschutz