Aktuelle Termine
27.09.2023-15.07.2024, Hamburg-Altona
Eine Sonderausstellung spannt einen Bogen vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart und zeigt, dass die Geschichte der Glaubensfreiheit eine Geschichte über Freiheiten und Grenzen ist. Auch unsere reformierte Gemeinde konnte bekanntlich ab 1602 in Altona siedeln und eine Kirche an der Großen Freiheit errichten. Die Ausstellung erzählt Altonas Glaubens- und Freiheitsgeschichte und führt die religiöse Vielfalt damals wie heute vor Augen. Einen lebendigen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart soll die Ausstellung ermöglichen, denn auch heute muss um Freiheiten gerungen werden. Weltweit ist die Freiheit zu glauben - oder nicht zu glauben - ein Vorrecht weniger.
Schon im Oktober 2020 stand die Ausstellung auf der Agenda. Dann kam die Pandemie und hat die Ausstellung ausgebremst. Jetzt endlich ist sie erneut zugänglich. Damals hat Kuratorin Dr. Hirsch über ein halbes Jahr den Kontakt zu unserer Gemeinde gepflegt. Im gemeinsamen Gespräch haben wir die reformierte Gemeindegeschichte erforscht und Exponate für die Ausstellung ausgewählt. So stellten wir dem Altonaer Museum alte Abendmahlskelche, eine alte französische Bibel und ein französisches Gesangbuch als Leihgaben zur Verfügung. Diese Exponate werden gleich im Eingangsteil der Ausstellung zu sehen sein... neben jüdischen, katholischen und mennonitischen Leihgaben. Außerdem sind Videoclips von Gemeindegliedern zum Thema „Glaubensfreiheit“ zu sehen. Und die Familiengeschichte der Familie Boué ist – exemplarisch für eine hugenottische Flüchtlingsfamilie – dokumentiert.
Eine unserer Leihgaben ist die silberne Abendmahlskanne, die von Johann Peter Menadier gespendet wurde (siehe Abbildung). Er ist der Erfinder der Altonaischen Kronessenz. In unserer Dauerausstellung – so schreibt Dr. Hirsch - findet sich folgender Text über ihn:
Nach der Vertreibung der französischen Protestanten, der Hugenotten, aus Frankreich bildete sich ab 1685 auch in Altona eine franzö- sisch-reformierte Gemeinde. Der Hugenotte Johann Peter Menadier (1735–1797) emigrierte nach Altona und verkaufte eine von ihm seit 1773 hergestellte Gesundheitsessenz, die „Essentia Coronata“. Ab 1796 ist das Mittel als „Keisserliche privilegirt Altonatiche W. Krones- sents“ nachweisbar. In kleinen Glasflaschen wurde die Kräutertinktur als „Wundermedizin“ gegen eine Vielzahl von Erkrankungen verkauft und weltweit verbreitet. Nach Menadiers Tod führte seine Witwe Anna Cecilia geb. Sparka die Geschäfte weiter. Die Firma „J. P. Menadier Wwe & Sohn“ wurde 1951 von der Firma Asche & Co. AG übernommen, die seit 1972 zur Schering AG gehört.
Workshop „Zeitenwende in der Friedensethik“
10. Juni 2023, 15-17 Uhr
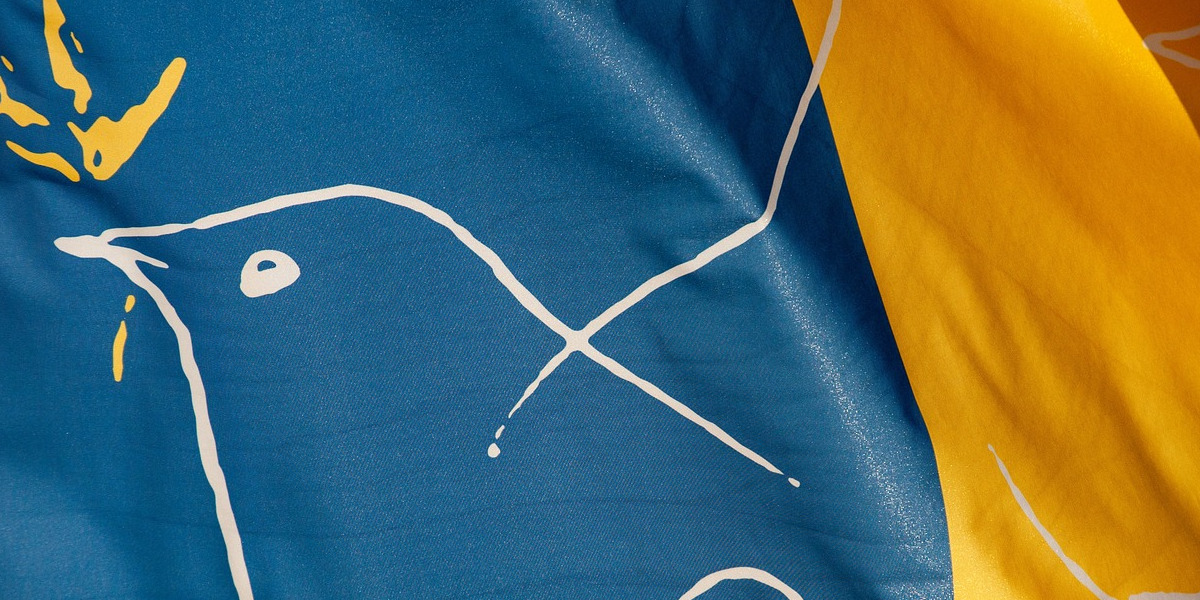
Kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges sprach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) von einer „Zeitenwende“: „[Der russische Überfall] bedroht unsere gesamte Nachkriegsordnung“. Tatsächlich haben sich friedens- und sicherheitspolitische Debatten in Europa seitdem verschärft. Wie lässt sich Krieg diplomatisch lösen? Gibt es Grenzen? Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung: Ist das okay?
Auch evangelische Kirchen beteiligen sich an den Debatten. Der Reformierte Bund betonte bereits in seiner Friedenserklärung vor mehr als 40 Jahren unter dem Titel „Nein ohne jedes Jahr“, für staatliche Machtmittel gebe es eine „durch das Gebot des Herrn gesetzte Grenze, die nicht überschritten werden darf“. In seinem Zwischenruf aus dem Jahr 2018 erklärte er: „In Christus sind wir alle mit Gott und darum auch miteinander versöhnte Menschen, die sich nicht wie Unversöhnte meiden, bedrohen, abschrecken oder gar vernichten dürfen.“ Und kurz nach dem Beginn des Ukrainekriegs erneuerte er seinen Aufruf: „Angesagt ist keine eskalierende Konfrontation, sondern eine politische und militärische Deeskalation, die zum Ausgleich der Interessen und zu einer neuen Entspannungspolitik beiträgt.“
Zusammen mit mit unseren Workshop-Gästen Tobias Zeeb, Christine Schliesser, Micael Grenholm und Prof. Christo Thesnaar diskutieren wir über friedensethische Fragen nach dem Ukrainekrieg: Gilt die Idee eines gerechten Friedens noch - oder müssen wir frühere pazifistische Haltungen als zu optimistisch revidieren? Wie gehen wir aus friedensethischer Sicht mit dem Krieg in Europa um?
Der Workshop startet mit einer thematischen Einleitung, mit anschließender Gruppenarbeit. Bei dieser Gelegenheit können sich Kirchentagsbesucher*innen und junge Wissenschaftler*innen zu aktuellen Friedensfragen austauschen.
Tobias Zeeb ist Theologe, Friedensethiker und Seelsorger in Kaufbeuren. Als Promotionsstipendiat der FEST beschäftigte er sich mit dem Projekt "Orientierungswissen zum gerechten Frieden - Im Spannungsfeld zwischen ziviler gewaltfreier Konfliktprävention und rechtserhaltender Gewalt". Im Interview mit uns sagt Zeeb: „Frühere Vorstellungen eines durch internationales Recht gesicherten Friedens gelten mit heutigen Erfahrungen oft als zu optimistisch.“
Dr. Christine Schliesser ist Studienleiterin am ökumenischen Zentrum für Glaube und Gesellschaft der Universität Fribourg und Privatdozentin für Systematische Theologie und Ethik an der Universität Zürich. In ihrer Habilitationsschrift beschäftigt sie sich mit der „Rolle der Theologie im öffentlichen Ethikdiskurs. Eine Analyse an den Beispielen des Deutschen Ethikrates (DER) und der Schweizer Nationalen Ethikkommissionen (EKAH und NEK)“.
Micael Grenholm ist Theologe an der Universität Lund (Schweden), engagiert sich bei "Pentecostals & Charismatics for Peace & Justice" (Pfingstler und Charismatiker für Frieden und Gerechtigkeit) und hat mehrere christliche Bücher auf Schwedisch zu Themen wie Wunder und Mitgefühl mit Flüchtlingen geschrieben.
Prof. Christo Thesnaar ist Theologe an der Unversität Stellenbosch (Südafrika). In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Fragen zu sozialer, politischer und religiöser Versöhnung wie auch Prozessen der Heilung.
Beim Kirchentag 2023 ist der Theologe zu Gast beim Reformierten Bund in Sankt Martha, mit dem Workshop "Friedensethik nach der 'Zeitenwende'" - vorab sprach er mit uns darüber, wie sich der Friedensdiskurs seit dem Ukrainekrieg gewandelt hat.






